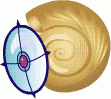Mit My Web Pages Starter Kit hat Microsoft kürzlich ein einfaches Open Source Content Management System veröffentlicht, das auf dem .NET-Framework 2.0 basiert und ohne Datenbank auskommt. Das CMS ist mit folgenden Modulen ausgestattet: HTML, Events, Links, Guest Book, Contact Form, Downloads, RSS und Gallery. Grossen Wert wurde auf eine einfache Lokalisierbarkeit gelegt.
My Web Pages ist insgesamt deutlich einfacher gehalten als beispielsweise DotNetNuke, wie das Positioning Statement klar macht. Das CMS kann sofort produktiv genutzt werden, ist aber auch als Studienobjekt für ASP.NET-Programmierer gedacht. My Web Pages wird unter der Microsoft Permissive License (Ms-PL) veröffentlicht und steht auf CodePlex – Microsofts Plattform für Open-Source-Projekte – zum Download bereit. Eine Demo-Website ist unter www.mwpsk.org zu sehen.
Fragen an Thorsten D. Künnemann, Projektleiter von My Web Pages
Open Mind: Wie kommt Microsoft dazu, ein Open Source CMS zu entwickeln?
Thorsten D. Künnemann: Der in der Frage implizierte Widerspruch ist eigentlich keiner. Microsoft ist ja nicht nur der Entwickler des Windows-Betriebssystems und des Office-Software-Pakets, sondern stellt mit dem .NET Framework, verschiedenen Server-Lösungen und Programmiersprachen auch anderen Entwicklern die Rahmenbedingungen für die Entwicklung eigener Software zur Verfügung.
Microsoft wollte einen einfachen Einstieg in die Welt von ASP.NET 2.0 schaffen. Statt sich gleich am Anfang mit den technischen Details auseinandersetzen zu müssen sollte eine funktionsfähige Applikation die Leistungsfähigkeit der Technologie beweisen und den Webmastern ein einfach zu bedienendes CMS zur Hand geben.
Erst mit individuellen Anpassungswünschen kann man dann Aufbau und Syntax von ASP.NET 2.0 kennen lernen. Ausserdem erhalten Entwickler Einblick in den Source Code des CMS, um einerseits den Einsatz der neuen Technologien am Fallbeispiel kennen zu lernen und andererseits an der Weiterentwicklung des CMS zu partizipieren. Nur mit einem kostenlosen Open Source CMS lassen sich diese Ziele erreichen. Bereits heute sind verschiedene Entwickler weltweit an dem Projekt beteiligt, sie liefern Lokalisierungen für andere Länder und Sprachen, zusätzliche Module und Bugfixes.
Wichtig ist vor allem, viele Entwickler von den Vorteilen des .NET Frameworks zu überzeugen und langfristig natürlich auch die Zahl von Websites auf Microsoft IIS Servern zu erhöhen, denn das CMS benötigt das .NET Framework dieser Server.
Open Mind: Kann man My Web Pages auch als Nicht-Programmierer bedenkenlos für eine produktive Website einsetzen oder ist es doch primär als Demo für .NET-Entwickler gedacht?
Thorsten D. Künnemann: Das My Web Pages CMS kann von jedem Nicht-Programmierer für produktive Websites eingesetzt werden: Die Dateien werden einfach auf den Webserver geladen und die Konfigurationsseite direkt im Web-Browser geöffnet, der normale User sieht im Idealfall keine einzige Zeile Code. Lediglich bei der Rechtevergabe für einen speziellen Applikationsordner kann es je nach Hosting-Partner nötig sein, kleinere Anpassungen vorzunehmen; diese sind im Paket beschrieben. Es braucht einen ASP.NET 2.0 Hosting Partner.
Open Mind: Was hat My Web Pages, was andere Open Source CMS nicht hat? Anders gefragt: Warum braucht es ein weiteres Open Source CMS?
Thorsten D. Künnemann: Jeder User mag andere Vorteile in diesem CMS erkennen. So bietet das My Web Pages Starter Kit viele Module wie ein Gästebuch, eine News- und Event-Liste oder eine Bildergallerie, deren Betrieb aber keine komplizierte Datenbankinstallation benötigt, wie bei manch anderem CMS mit gleichem Funktionsumfang. Die Daten werden in XML Dateien gespeichert. (Ein Entwicker der Community hat allerdings auch schon ein Plugin für die Integration einer SQL Datenbank geschrieben).
Das My Web Pages Starter Kit bietet mit neun verschiedenen Content-Modulen, einem Rich-Text- und einem HTML-Editor, einer User-Verwaltung und einer RSS-Feed-Generierung alles, was es für umfangreiche Websites braucht. Es zeichnet sich aber gegenüber vielen anderen CMS durch eine geringere Komplexität in der Bedienung aus. Der Einsatz von Master Pages in ASP.NET erlaubt nicht nur, alle Eigenschaften der Webseiten global zu definieren, sondern auch das Design der gesamten Website mit nur einem Klick komplett zu ändern.
Das CMS wird bereits mit einem Dutzend verschiedener Designs geliefert. Jede Seite kann inviduell mit Hilfe der Module gestaltet werden, der Einsatz vieler vordefinierter Module im ASP.NET Framework erleichtert und beschleunigt den Bau einer Website. Ein Easy-Control-Modul erleichtert zudem den Einbau neuer, selbst entwickelter Module.
Open Mind: Aktuell ist die Version 1.0.3 Stable von My Web Pages verfügbar, seit kurzem steht auch der Release Candidate 1.1 zum Download bereit. Wie geht es mit dem Projekt weiter? Geht es überhaupt weiter?
Thorsten D. Künnemann: Das Projekt wird auf der Codeplex-Plattform kontinuierlich weiterentwickelt. Unsere Entwickler und die Community liefern Ergänzungen, Bugfixes und neue Lokalisierungen für neue Releases. Die Version 1.1 enthält weitere Lokalisierungen, darunter auch eine für Arabisch inklusive einer neuen Master Page für das dafür benötigte rechtsbündige Layout und den Recht-Links-Textverlauf.
Disclosure: Der Betreiber dieses Blogs ist – wie Thorsten D. Künnemann – Angestellter von Futurecom interactive AG, welche My Web Pages Starter Kit im Auftrag von Microsoft EMEA entwickelt hat.