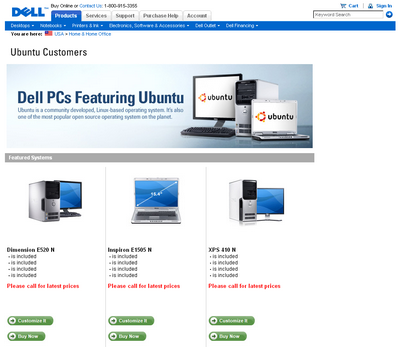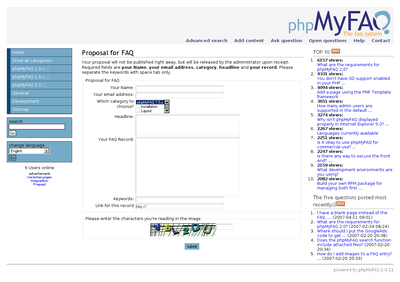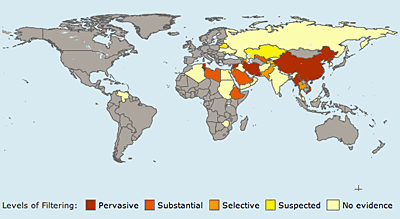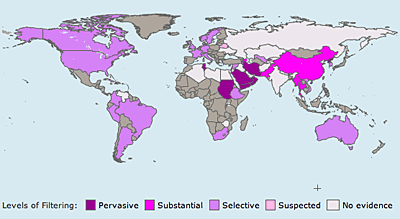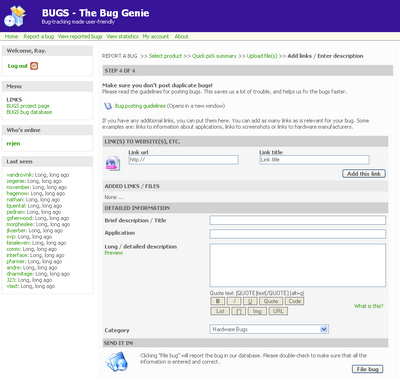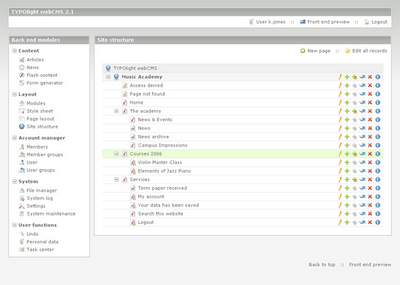Beim Instant Messaging (IM) zeigt sich beispielhaft wohin es führt, wenn Software-Unternehmen im Interesse ihrer Marktstellung jeweils eigene Standards etablieren (und diese sogar aktiv gegen aussen abschotten). Mit AOL, Microsoft und Yahoo! mischen in dieser Disziplin verschiedene Branchenriesen mit, die sich nichts schenken. Die positive Ausnahme stellt Google dar, dessen IM-Dienst Google Talk auf dem offenen XMPP-Protokoll (Jabber) basiert.
Wer mit seinen Freunden und Geschäftspartnern Instant Messages austauschen will, muss also in der Regel über bis zu vier verschiedene Dienste kommunizieren. Das ist etwa so praktisch wie wenn es vier verschiedene E-Mail-Systeme gäbe, für die man jeweils eigene E-Mail-Konti und E-Mail-Programme nutzen müsste. Glücklicherweise gibt es von unabhängigen Anbietern Multi-Protokoll-IM-Clients, die mit allen vier grossen Diensten gleichzeitig kommunizieren, und darunter finden sich auch gute Open-Source-Lösungen.
Pidgin ist ein neuer Name für eine etablierte Software, die früher Gaim hiess, sich aber wegen eines Rechtsstreits mit AOL umbenennen musste (der AOL Instant Messenger ist unter dem Kürzel AIM bekannt). Sie ist für Windows und Linux verfügbar, untersteht der GNU General Public Licence GPL und liegt seit kurzem in der Version 2.0 vor. Pidgin unterstützt AIM, ICQ, Jabber/XMPP, MSN Messenger, Yahoo!, Bonjour, Gadu-Gadu, IRC, Novell GroupWise Messenger, QQ, Lotus Sametime, SILC, SIMPLE und Zephyr.
Das Pendant unter Mac OS X ist Adium, das ein eigenständiges Programm darstellt, aber auf derselben Code-Library (libpurple) aufbaut. Adium ist noch jung – die Version 1.0 ist erst einige Monate alt – und kommuniziert mit AIM (inkl. ICQ und .Mac), Jabber (inkl. Google Talk), MSN Messenger, Yahoo! Messenger, Bonjour (iChat), Gadu-Gadu, LiveJournal, Novell Groupwise, QQ und Lotus Sametime. Das ist deutlich mehr als Apples eigenes IM-Programm iChat, das immerhin AIM, .Mac und Jabber unterstützt – auf der anderen Seite bietet Adium (noch) keine Audio- und Video-Chat-Funktionen. (Einen ausführlichen Vergleichstest gibt es bei Apple Matters.)