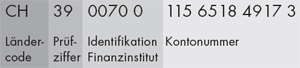Der Blick zückt die „Rote Karte für unnötige Radarfallen!“ und schürt damit den Volkszorn über „die reinste Abzocker-Schikane“ der Waadtländer Polizei. Diese hat entlang der Autobahn A1 ein gutes Dutzend neue Radarfallen installiert, die nicht von weit her sichtbar, sondern in der Mittelleitplanke versteckt sind. „So nicht“, schreibt der Wissenschaftsredaktor Reto Kohler, sondern so: „Eine gut sichtbare Radaranlage vor einem Fussgängerstreifen erhöht die Verkehrssicherheit.“
Mit anderen Worten: Nur eine Radarfalle, die jeder sieht (und vor der man somit kurz runterbremsen kann), ist eine gute Radarfalle. Wenn man dagegen an einem Ort geblitzt wird, wo man nicht damit gerechnet hat, dann ist das sinnlos (weil dann ja keiner bremst) und somit reine „Abzockerei und Wegelagerei des Staates“ (Zitat Radar-Info-Zentrale). Mobile und versteckte Radarfallen sind also böse Radarfallen.
Wenn ich mich kurz beim Jugend-Slang bedienen darf: HALLO? Wer so redet (oder schreibt), meint doch im Prinzip, dass auf unseren Strassen freie Fahrt gilt, so lange man der Polizei die Genugtuung lässt, dass man bei den allseits bekannten Blechpolizisten kurz das Unschuldslamm spielt. Das mögen sich viele Autofahrer wünschen, aber es entspricht nicht der Realität – zum Glück, möchte ich anfügen, denn echte Verkehrssicherheit kann sich nicht darauf beschränken, dass Tempolimiten nur auf 0.5 Promille des Strassennetzes eingehalten werden.
Regeln werden bekanntlich dann befolgt, wenn deren Übertretung Konsequenzen hat, die weh tun. Dass man Geschwindigkeitsübertretungen mit Bussen ahndet, macht unter diesem Aspekt absolut Sinn, wie das Wehgeschrei der Autolobby beweist. Wer dies als unrechtmässige Bereicherung der Staatskasse empfindet, darf aber gerne auch „bargeldlose“ Formen der Bestrafung vorschlagen. Wie wäre es beispielsweise mit 1 Tag Freiwilligenarbeit in einer Unfallklinik pro 10 km/h zuviel?
Im Prinzip ist es doch ein Spiel mit ganz einfachen Regeln. Und wer dabei erwischt wird, wenn er die Regeln bewusst bricht, soll es tragen wie ein Mann (oder eine Frau) – und nicht darüber lamentieren, dass sich die Gegenseite nicht an die Regeln hält. Wenn nur jene erwischt würden, die dümmer sind als die Polizei erlaubt, dann wäre das Spiel ja auch ein bisschen reizlos, oder?
Nachtrag: Im Tages-Anzeiger desselben Tages lese ich folgende Schlagzeile:
„Pro Woche sterben auf Europas Strassen 800 Menschen“
Das entspricht 2 Jumbo-Abstürzen pro Woche. Und schuld daran ist – nebst anderen Gründen – eben auch das Tempo:
„Hauptursache für die tödlichen Unfälle seien das Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit, Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss und das Nichttragen der Sicherheitsgurte.“